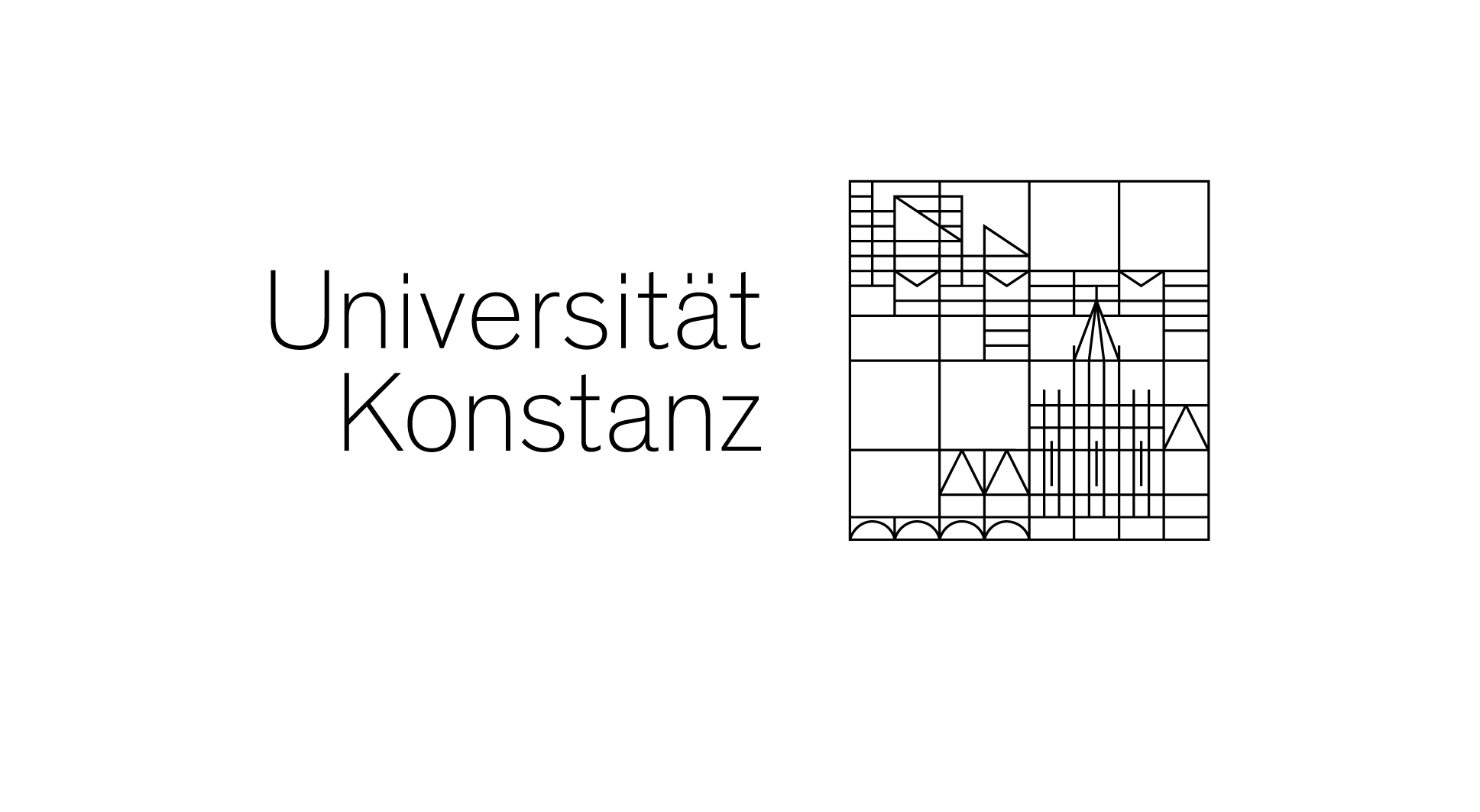Handreichungen
Rechtsfragen digitaler Lehre

Hier finden sich alle bereits veröffentlichten Handreichungen der Rechtsinformationsstelle für die digitale Lehre Baden-Württemberg bwDigiRecht.
Ihr Feedback zu den Handreichungen unterstützt bwDigiRecht bei der Qualitätsentwicklung. Wir freuen uns über ihre Rückmeldungen! Füllen Sie dafür gerne das Formular im jeweiligen Registerabschnitt der betreffenden Handreichung aus. Herzlichen Dank!
Die bereitgestellten Handreichungen stellen allgemeine rechtliche Informationen dar und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte beachten Sie, dass hochschulspezifische Regelungen abweichen können. Für die Anwendung in der eigenen Einrichtung empfiehlt sich die Rücksprache mit den zuständigen Stellen vor Ort.
18.09.2025
Die ▶Handreichung erläutert, wie die europäische KI-Verordnung auf dual Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg anzuwenden ist. Im Mittelpunkt stehen die Abgrenzung zwischen privater und beruflicher Nutzung von KI sowie die Frage, ob duale Studierende von regulatorischen Ausnahmen profitieren können.
06.02.2025
Diese ▶Handreichung untersucht die rechtlichen Grundlagen für die Aufbewahrung und Einsichtnahme bei digitalen Prüfungen. Sie analysiert zudem den Regelungscharakter der Prüfungsergebnisse und klärt den Prüfungsumfang sowohl im Vorverfahren als auch vor Gericht. Zunächst werden analoge Prüfungen betrachtet, um die gewonnenen Erkenntnisse abschließend auf digitale Prüfungen zu übertragen.
31.01.2025
Die ▶Handreichung BYOD Prüfungen beleuchtet den Einsatz privater Endgeräte bei der Durchführung von Prüfungen im Hochschulkontext aus rechtlicher Perspektive. Neben der Rechtsgrundlage hierfür behandelt sie Rechte und Pflichten der Studierenden sowie der Hochschulen und die technische Chancengleichheit.
09.05.2025
Diese Handreichung befasst sich mit dem ▶Datenschutz bei elektronischen Fernprüfungen. Zunächst wird der Begriff der elektronischen Fernprüfung definiert. Sodann werden mögliche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei elektronischen Fernprüfungen diskutiert. Es folgen allgemeine Ausführungen zu der von der Hochschule durchzuführenden Verhältnismäßigkeitsprüfung im Kontext des Datenschutzes bei elektronischen Fernprüfungen. Des Weiteren werden Maßnahmen und Pflichten der Hochschule sowie Rechte der Studierenden, zum einen aus der DSGVO, zum anderen aus dem Landesrecht dargestellt. Es wird zudem auf die Zulässigkeit besonderer Maßnahmen wie dem Safe Exam Browser im Rahmen von elektronischen Fernprüfungen eingegangen. Abschließend erfolgt eine Übersicht über die derzeitige Hochschulpraxis.
11.08.2025
Diese Handreichung ▶ Digitale Anwesenheitspflicht befasst sich mit der digitalen Anwesenheitspflicht aus hochschulrechtlicher Perspektive. Zunächst werden die einschlägigen rechtlichen Grundlagen dargestellt. Im Anschluss erfolgt eine Übertragung der bestehenden rechtlichen Erkenntnisse auf den Kontext digitaler Lehrveranstaltungen. Darüber hinaus werden zentrale Aspekte analysiert, die im Rahmen vergangener Rechtmäßigkeitsprüfungen von Bedeutung waren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung digitaler Anwesenheitspflichten: Es wird exemplarisch aufgezeigt, wie ausgewählte Hochschulen entsprechende Regelungen in ihren Prüfungsordnungen verankern. Abschließend werden technische Möglichkeiten zur Umsetzung einer digitalen Anwesenheitspflicht erörtert.
27.03.2025
Diese Handreichung behandelt die ▶Digitalisierung der Form und Bekanntgabe von Prüfungsbescheiden. Es wird der Begriff der Form definiert und die verschiedenen existierenden Formen erläutert. Im weiteren Verlauf wird erörtert, wie Prüfungsbescheide in einer digitalisierten Verwaltung bekanntgegeben werden können, einschließlich der Frage, ob die Übermittlung per E-Mail ausreicht, wenn die empfangenden Personen den Bescheid selbst ausdrucken. Außerdem wird die elektronische Verwaltungskommunikation thematisiert. Dies wird im Kontext der aktuellen Digitalisierungsbestrebungen des Gesetzgebers analysiert, wobei die Auswirkungen des E-Government-Gesetzes Baden-Württemberg und des Onlinezugangsgesetzes betrachtet werden. Schließlich wird das Verhältnis ausgewählter relevanter Normen geklärt.
UPDATE, 14.05.2025
Im Nachgang zur Handreichung Digitalisierung der Form und Bekanntgabe von Prüfungsbescheiden erreichte bwDigiRecht die Frage nach dem Verhältnis zwischen § 63 Abs. 2 Satz 4 Landeshochschulgesetz (LHG) und § 9 Onlinezugangsgesetz (OZG). In der ▶Ergänzung wird dieses Verhältnis behandelt.
28.02.2025
Diese ▶ Handreichung untersucht die E-Prüfungen im Rahmen der juristischen Staatsprüfungen, insbesondere der Ersten und Zweiten Staatsprüfung. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, den Ablauf der E-Prüfungen sowie deren Umsetzung in verschiedenen Bundesländern und analysiert, inwieweit Universitäten künftig E-Prüfungskompetenz vermitteln müssen.
04.07.2025
Die ▶Handreichung befasst sich mit der Einordnung von Hochschulen im Rahmen der Anbieter- und Betreiberpflichten gemäß der europäischen KI-Verordnung. Zunächst werden die Begriffe der Anbieter und Betreiber im Sinne der KI-Verordnung erläutert. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, ob die in der KI-Verordnung vorgesehene forschungsbezogene Privilegierung auch auf die Lehre übertragbar sind. Im weiteren Verlauf werden unterschiedliche Anwendungsszenarien untersucht, in denen Hochschulen oder Hochschulangehörige KI-Systeme entwickeln, entwickeln lassen oder modifizieren. Auf dieser Grundlage erfolgt eine rechtliche Einordnung der jeweiligen Rollen der beteiligten Personen im Kontext der KI-Verordnung. Abschließend werden die sich aus diesen Rollen ergebenden rechtlichen Verpflichtungen dargestellt und im Hinblick auf ihre praktische Relevanz für den Hochschulbereich bewertet.
UPDATE, 09.07.2025
Eine ▶Ergänzung zur Handreichung Hochschulen im Rahmen der Anbieter- und Betreiberpflichten analysiert, inwiefern dual Studierende unter die Betreiber‑ bzw. Haushaltsausnahme der KI‑Verordnung fallen. Es wird festgestellt, dass dual Studierende nicht per se vom Anwendungsbereich der KI‑VO (Art. 2 Abs. 10) ausgenommen sind, weil die Ausnahme von einer ausschließlich persönlichen und nicht‑beruflichen Nutzung abhängt, während die Betreiberausnahme (Art. 3 Nr. 4) diese Voraussetzung nicht stellt; aufgrund fehlender Rechtsliteratur und Rechtsprechung lässt sich jedoch keine abschließende rechtliche Bewertung geben.
28.03.2025
Die Handreichung ▶KI in Prüfungsszenarien analysiert den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Hochschulprüfungen und unterscheidet zwischen KI-robusten Prüfungsformaten, die KI-Nutzung durch rechtliche und technische Restriktionen unterbinden, und KI-integrierenden Ansätzen, die KI aktiv als Werkzeug oder Lerngegenstand einbeziehen. Unterschiedliche Prüfungsszenarien – von Präsenz- bis Absenzformaten – erfordern differenzierte Strategien zur Integritätssicherung, wobei die Unzuverlässigkeit von KI-Erkennungssystemen und rechtliche Unsicherheiten zentrale Herausforderungen darstellen. Kritisch diskutiert wird die Beweisbarkeit von KI-Nutzung, insbesondere durch Methoden wie den Anscheinsbeweis, der rechtliche und ethische Fragen aufwirft.
05.03.2025
Die Handreichung ▶ KI-Kompetenz – Qualifizierungsanforderungen für Hochschulangehörige gibt einen Überblick über die Anforderungen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit KI-Kompetenz im Hochschulbereich, basierend auf der KI-Verordnung. Im Fokus stehen Qualifizierungsmaßnahmen zur Förderung von KI-Kompetenzen sowie die Rollen der Hochschulen als Anbietende oder Betreibende von KI-Systemen. Die Handreichung soll Hochschulen dabei unterstützen, zielgruppenspezifische Schulungskonzepte zu entwickeln, um eine verantwortungsvolle und rechtskonforme Nutzung von KI in Lehre, Forschung und Verwaltung sicherzustellen.
25.11.2025
Diese ▶Handreichung dient der Orientierung bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) im wissenschaftlichen Arbeiten. Sie integriert aktuelle Empfehlungen, erläutert relevante rechtliche Rahmenbedingungen und hochschuldidaktische Perspektiven und bietet praxisorientierte Hinweise zur Formulierung von Eigenständigkeitserklärungen sowie zum verantwortungsvollen Einsatz KI-gestützter Werkzeuge.
29.01.2025
Die ▶ Recherche Streaming im Rahmen hybrider Lehre beschäftigt sich mit den Fragen, ob es bei hybriden Lehrveranstaltungen erforderlich ist, einen Bereich auszuweisen, der nicht von der übertragenden Kamera erfasst wird und ob es ausreichend ist, die Studierenden auf die alternative Online-Teilnahme zu verweisen, sollten sie nicht in Präsenz von der Kamera erfasst werden wollen. Zu diesen Fragen werden einschlägige Auffassungen aus der rechtswissenschaftlichen Literatur zusammengefasst und ein Zwischenfazit formuliert, welches eine handlungsleitende Orientierung darstellt.
23.05.2025
Die Handreichung ▶Rechtsbereichsspezifische Betrachtung von KI: KI und Datenschutz untersucht die rechtlichen Implikationen des Einsatzes von Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Lehre im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Anforderungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie der KI-Verordnung. Im Fokus stehende zentrale Fragestellungen betreffen die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch KI-Systeme. Dabei werden die datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen differenziert betrachtet und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im Kontext von KI bewertet. Im Hochschulkontext werden die Anforderungen wie das Prinzip der Datenminimierung, die Erfüllung von Transparenzpflichten und der Umgang mit automatisierten Entscheidungen näher betrachtet. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele, etwa des Einsatzes von Proctoring-Software bei Prüfungen, werden zentrale rechtliche Herausforderungen, einschließlich der datenschutzrechtlichen Bewertung von Datenübermittlungen in Drittstaaten, herausgearbeitet.
28.04.2025
Die Handreichung ▶ Rechtsbereichsspezifische Betrachtung von KI: KI und Grundrechte beleuchtet die rechtlichen Herausforderungen bei der Integration von Künstlicher Intelligenz im Hochschulkontext, insbesondere im Hinblick auf die Grundrechte. Sie untersucht, wie technologische Innovationen wie Deepfakes das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht am eigenen Bild und die Wissenschaftsfreiheit beeinträchtigen können, und welche rechtlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Schutz dieser Rechte zu gewährleisten. Abschließend wird die Rolle der europäischen KI-Verordnung in der Regulierung von KI-Technologien im Bildungsbereich und deren Einfluss auf den Datenschutz sowie die Chancengleichheit im Hochschulwesen thematisiert.
07.08.2025
Im Zentrum der ▶Handreichung steht eine rechtsbereichsspezifische Analyse des Urheberrechts im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Gegenstand der Darstellung sind zentrale Begriffe und gesetzliche Vorschriften, wie der urheberrechtliche Werkbegriff, das Vervielfältigungsrecht gemäß § 16 Urheberrechtsgesetz (UrhG) sowie die Schrankenregelungen für Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Auslegung dieser Normen im Kontext aktueller technischer Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die automatisierte Auswertung großer Datenmengen und die Verwendung KI-generierter Inhalte im Hochschulbereich.
Diese ▶Handreichung untersucht umfassend die rechtlichen Implikationen von KI-integrierenden Prüfungen im Hochschulkontext. Nach einer begrifflichen Einordnung des Konzepts werden exemplarische Anwendungsszenarien vorgestellt, in denen KI-Systeme organisatorisch oder funktional in Prüfungsprozesse eingebettet sind. Im Anschluss erfolgt eine systematische Analyse der hieraus resultierenden juristischen Fragestellungen, gegliedert nach den einzelnen Phasen des Prüfungsprozesses, von Vorbereitung und Durchführung bis zur Bewertung. Abschließend werden anhand konkreter Beispiele KI-integrierender Prüfungsformen die aktuell in der Praxis angewandten Lösungen zu den relevanten Rechtsfragen dargestellt und kritisch gewürdigt. Diese Handreichung vertieft damit die Betrachtung der rechtlichen Aspekte von KI-integrierenden Prüfungen, die in der Publikation „Künstliche Intelligenz in Prüfungsszenarien“ der Rechtsinformationsstelle bwDigiRecht bislang nur am Rande behandelt wurden.
05.02.2025
Diese ▶ Handreichung beleuchtet den Einsatz des „Safe Exam Browsers (SEB)“ bei der Durchführung von Prüfungen im Hochschulkontext aus rechtlicher Perspektive. Es wird erörtert, auf welcher Rechtsgrundlage der SEB eingesetzt werden kann. Zudem wird aufgeführt welche Funktionalitäten der SEB bietet und welche Vorteile und praktischen Herausforderungen hieraus erwachsen.
02.10.2025
Diese ▶Handreichung widmet sich dem Einsatz von Streaming im Kontext hybrider Lehrformate. Nach einer begrifflichen Einordnung von Streaming und hybrider Lehre werden die zentralen rechtlichen Rahmenbedingungen analysiert, mit einem Schwerpunkt auf urheber- und datenschutzrechtlichen Aspekten. Im Anschluss werden praxisnahe Umsetzungsmöglichkeiten erörtert sowie eine Checkliste bereitgestellt, welche relevante rechtliche und organisatorische Aspekte für die Durchführung von Streaming in der hybriden Lehre systematisch zusammenfasst. Die Handreichung knüpft inhaltlich an die am 29.01.2025 veröffentlichte Recherche zum Streaming in der Hochschullehre an und führt diese vertiefend fort.
19.11.2025
Diese ▶Handreichung beleuchtet die rechtlichen Implikationen des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) im Hinblick auf spezifische Hochschullehrangebote. Behandelt wird neben weiteren Konstellationen insbesondere das Angebot kostenpflichtiger Hochschulveranstaltungen mit einem Selbstlernanteil von über 50 Prozent. Zunächst wird geklärt, inwiefern Hochschulen generell unter den Anwendungsbereich des FernUSG fallen. Des Weiteren werden die einzelnen Tatbestandsmerkmale, die für die Eröffnung des Anwendungsbereichs des FernUSG im hochschulischen Kontext entscheidend sind, geklärt. Schließlich wird über die Rechtsfolge des Vorliegens eines Fernlehrgangs informiert.
13.03.2025
Diese Handreichung bietet eine kompakte ▶Zusammenfassung der Europäischen KI-Verordnung speziell für den Hochschulbereich. Sie beleuchtet die wichtigsten Regelungen, insbesondere im Umgang mit Hochrisiko-KI-Systemen in Lehre und Forschung, und gibt einen Überblick über die anstehenden Verpflichtungen für Hochschulen. Ziel dieser Handreichung ist, Hochschulangehörigen eine systematische Orientierung zu geben, um die Anforderungen der KI-Verordnung im Hochschulkontext zu verstehen und umzusetzen.
Kontakt
________________________________

Elisabeth Lampart
Koordinatorin bwDigiRecht
✉ bwDigiRecht@hnd-bw.de

Maximilian Spehn
Rechtsexperte bwDigiRecht
✉ bwDigiRecht@hnd-bw.de

Jana Knecht
Rechtsexpertin bwDigiRecht
✉ bwDigiRecht@hnd-bw.de
Newsletter
________________________________
Anmeldung für den ▶ Newsletter von bwDigiRecht